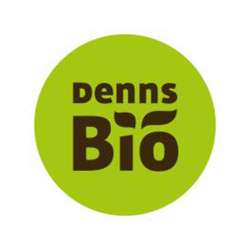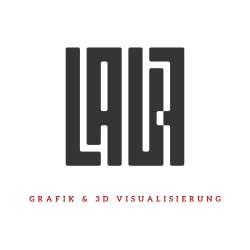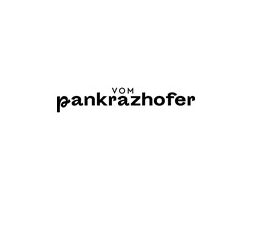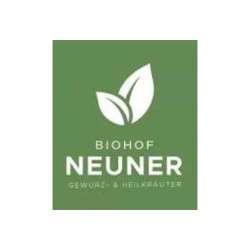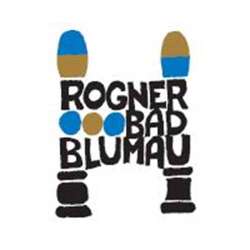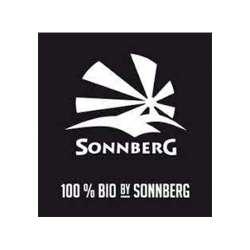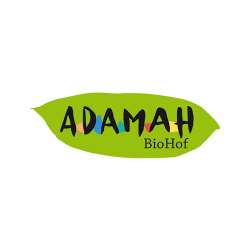Die Zukunft ist "Bioregional"
Warum Bioregionalität ein finanzielles Sparpaket für Österreich ist!
Wir alle kennen die alten Argumente wie „Bio ist zu teuer“ oder „Bio rechnet sich nicht“.
Auch die verbreiteten Angstvorstellungen wie „mit Bio verhungern wir alle“ und die Behauptung, dass unsere Natur (teure) chemisch-synthetische Pestizide und Kunstdünger benötigt, damit wir in Europa überleben, sind vielen noch präsent. Glücklicherweise erkennen wir zunehmend, dass nur ein funktionierendes, gesundes Ökosystem uns langfristig gut und leistbar versorgen kann.
Ja, aber verhungern wir ohne Massen an Kunstdünger nicht alle?
Ein großer Teil der Versorgungssicherheit kann durch die Reduktion von Lebensmittelabfällen und Fleischkonsum erreicht werden. Dies sind die größten Stellschrauben zur Sicherung unserer Versorgung, denn wir werfen nach wie vor ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weg, und über zwei Drittel unserer Ackerfläche sind für Futtermittel reserviert.
Zuerst ist die Verminderung der Lebensmittelverschwendung und des Fleischkonsums notwendig. Eine Intensivierung der Landwirtschaft macht nur noch dann Sinn, wenn sie durch bioregional vertretbare Maßnahmen wie Bio-Agroforst, Bio-Aquaponik oder Kreislaufwirtschaft unterstützt wird.

Das alte Denken der „konventionellen Intensivierung“, sprich noch mehr aus den Böden, Pflanzen und Tieren holen zu wollen, selbst wenn es gerne sanft dargestellt wird, sollten wir hinter uns lassen, denn es übersteigt oft die „planetaren Grenzen“ und ist mit hohen Folgen und Folgekosten verbunden – ganz regional und vor unserer Haustür.
Genau hier setzt die stärkste Nachhaltigkeitsbewegung Österreichs, das Enkeltaugliche Österreich (ETÖ), an und kämpft für die Umsetzung von Kostenwahrheit, denn sie bringt ans Licht, warum gerade biologischer Landbau uns generationenübergreifende, regionale Versorgungssichheit bringen kann.
Was ist Kostenwahrheit?
Die Folgen und Folgekosten einer intensivierten Landwirtschaft, wie der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden und Kunstdünger sowie die massiven Importe von Futtermitteln, wurden lange als unvermeidlich angesehen. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden jedoch nicht den Produkten zugerechnet. Für die entstandenen Umweltschäden zahlen die Steuerzahler:innen und die Allgemeinheit, meist ohne ihr Wissen, separat.
Beispiele für Folgekosten:
- Kunstdünger hilft kurzfristig, mehr aus dem Boden zu holen. Doch das „billiger“ und „mehr“ hat langfristige Folgen. Übermäßige Nährstoffeinträge in Böden und Gewässer führen zu hohen Nitratwerten im Trinkwasser, das dann teuer gereinigt werden muss. Nitrat im Trinkwasser kann insbesondere für Säuglinge und schwangere Frauen gesundheitliche Risiken darstellen. Zudem ist die Produktion von Stickstoffdüngern energieintensiv und trägt zur Freisetzung von Treibhausgasen bei.
- Chemisch-synthetische Spritzmittel, Pestizide und präventive Antibiotika, die in der bioregionalen Landwirtschaft nicht erlaubt sind, führen zu einem Verlust der Artenvielfalt, Gesundheitsproblemen, einer Abnahme der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und einer geringeren Wasseraufnahmefähigkeit der Böden. Diese realen Kosten tragen wir alle indirekt zum Beispiel in Form von Steuern. Ein höherer Bioregionalitäts-Anteil senkt diese Kosten und mindert die negativen Folgen.
Bedeutet das, dass wir für vermeintlich billigere Lebensmittel mehr zahlen, als uns bewusst ist?
Ja, das ist korrekt.
Wenn wir die Kostenwahrheit berücksichtigen, wird Bioregionalität zum finanziellen Sparkurs für Österreich. Bioregionale Lebensmittel sind letztlich und langfristig die kostengünstige Wahl für unser Land.
Bioregionale Bäuer:innen erbringen eine Vielzahl an Mehrleistungen und verhindern hohe Folgekosten, die die Gesellschaft sonst unwissentlich trägt. Es wird auch immer teurer werden, „billig“ und „intensiv“ zu produzieren.

Wie wird Bioregionalität in der Praxis zum „Sparprogramm“?
Beispiel: In der öffentlichen Beschaffung, also den Einkäufen des Bundes und der Länder, kann dies deutlich werden.
Kaufen diese mit unserem Steuergeld „billigere“ Lebensmittel für Schulen, Krankenhäuser, Kasernen, Seniorenheime etc., entstehen langfristig mehr Folgekosten für die Steuerzahler:innen und die Allgemeinheit. Die kurzfristige Kostenersparnis im Lebensmitteleinkauf wird, wenn man generationenübergreifend und langfristig denkt, zur viel teureren Variante. Zudem werden unsere bioregionalen Bäuer:innen und Bauern zum Export gedrängt, da im Inland meist „nicht-bio“ Ware in öffentliche Küchen kommt. Kaufen wir mit unserem Steuergeld hochwertige, nachhaltige und bioregionale Lebensmittel, ist der Preis zwar kurzfristig höher, aber die Folgekosten der Lebensmittelproduktion, massenhafter Futtermittelimporte und der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide sinken wiederum um ein Vielfaches.
Wenn wir zukunftsorientiert handeln, zahlen wir etwas mehr und kaufen nachhaltige Produkte. Dadurch ersparen wir uns viele Folgekosten und können die Mehrkosten für einen nachhaltigen, bioregionalen Einkauf aufbringen. Voraussichtlich bleibt sogar noch Geld übrig, das für soziale oder andere Zwecke genutzt werden kann. Ein Beispiel dafür wäre ein kostenloses bioregionales Schulessen für Kinder, das in die richtige Richtung geht.
Was können wir tun, damit die Kostenwahrheit „wahr“ wird?
Das Enkeltaugliche Österreich arbeitet daran, diese Wahrheit ans Licht und in die Umsetzung zu bringen. Die Bewegung hat es geschafft, die renommiertesten Wissenschafter:innen des Landes aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Diese arbeiten bereits daran, genau zu berechnen, wie viele Folgekosten die Landwirtschaft in Österreich verursacht und wie deren Verminderung einen positiven Effekt haben kann. Unsere Wirtschafts-, Rechts-, Politik-, und Landwirtschaftsexpert:innen sorgen dafür, dass praxisnahe Lösungen gefunden werden.

Anfang 2025 wird das Projekt den öffentlichen Stellen präsentiert.
Bleibt dran, es bleibt spannend!
Mach mit und werde Teil der Bewegung
Unsere Mitgestalter:innen und Unterstützer:innen